Rudolf
Frisius
KUNST UND KÜNSTLICHKEIT -
Zum Verhältnis von Technologie und künstlerischer Kreativität
TECHNOLOGIE UND KUNST -
Möglichkeiten und Grenzen der Technisierung von Kunst
und ihre Bedeutung für die Musik
Der Geist eines Kunstwerkes,
das Maß der Empfindung, das Menschliche, das in ihm ist -
sie bleiben durch wechselnde
Zeiten unverändert an Wert;
die Form, die diese drei
aufnahm,
die Mittel, die sie
ausdrückten,
und der Geschmack, den die
Epoche ihres Entstehens über sie ausgoß,
sie sind vergänglich und
rasch alternd.
Geist und Empfindung
bewahren ihre Art, so im Kunstwerk wie im Menschen;
technische Errungenschaften, bereitwilligst erkannt und bewundert, werden
überholt,
oder der Geschmack wendet sich von ihnen gesättigt ab. -
Die vergänglichen
Eigenschaften machen das „Moderne“ eines Werkes aus;
die unveränderlichen
bewahren es davor, „altmodisch“ zu werden.[1]
Mit
diesen Worten beginnt Feruccio Busoni
1906 seinen Entwurf einer neuen Ästhetik
der Tonkunst.
Das
Verhältnis zwischen Kunst und Technologie
beschreibt
er hier mit skeptisch eingrenzenden Worten -
mit
Worten, die seitdem möglicherweise weniger beachtet wurden
als
eine optimistische Zukunftsvision,
in
der er am Ende seines Traktats eine technogene Musik
als
Alternative zu der (nach seiner Auffassung)
in
ihren Mitteln und Ausdrucksmöglichkeiten erschöpften Instrumentalmusik
empfiehlt:
Plötzlich, eines Tages,
schien es mir klar geworden,
daß die Entfaltung der
Tonkunst an unseren Instrumenten scheitert.
(...)
Wohin wenden wir dann
unseren Blick, nach welcher Richtung führt der nächste Schritt?
Ich meine, zum abstrakten
Klange, zur hindernislosen Technik, zu tonlichen Unabgegrenztzeit.[2]
Was
erhoffte Busoni sich von der
Technik?
Was
verstand er unter Abstraktion, Hindernislosigkeit und Unabgegrenztheit?
Der
weite Abstand zwischen Utopie und Wirklichkeit,
wie
er 1906, zur Entstehungszeit dieses Manifestes, noch bestand,
wird
deutlich, wenn man Busonis hoch
gesteckte Ziele vergleicht,
mit
dem einzigen Notenbeispiel, das seine Zukunftsvisionen ein wenig konkretisiert:
Zwei
Notenzeilen mit zwei Ganztonleitern,
die,
einen Halbton voneinander entfernt,
jeweils
ihr Grundintervall, den Ganzton, in drei Teile teilen,
so
daß sich beim Ineinanderschieben beider Skalen eine Tonleiter in
Sechsteltonschritten ergibt.
c - d 200 Cents: 0 - 200
Aufteilung des
Ganztonschritts durch Dritteltonschritte:
66,66...+66,66...+66,6...
Cents: 0 - 66,66... - 133,33... - 200 (- 266,2 - 332,2...)
(h - ) des - es 200 Cents:
100 - 300
Aufteiliung des Ganztonschritts durch Dritteltonschritte:
66,6+66,6+66.6 Cents: (33,6
-) - 100 - 166,6 - 233,2 - 300
Verschränkung der beiden
Drittelton-Skalen ineinander: Sechsteltonskala:
0 - 33,33... - 66,66... -
100 - 133,2 - 166,6 - 200
c cis d
c x x d x x e x x fis x x
gis x x ais x x c, (h y y) des y y es y y f y y g y y a y y h y y des;
(c-x.-y) des-x-y-d-x-y-d-x-y
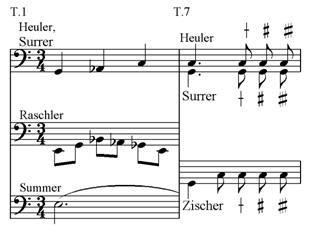
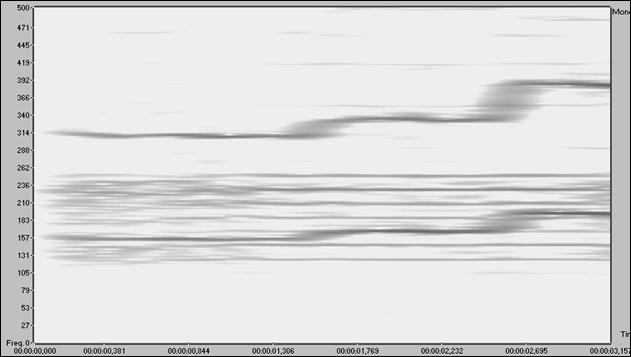

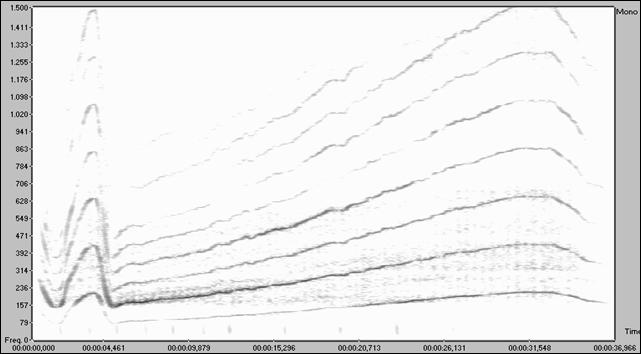
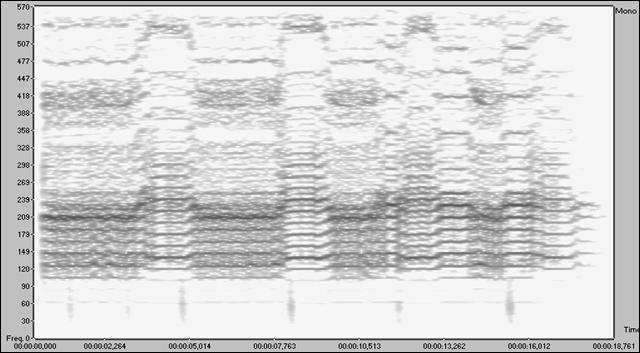
Abstrakter Klang -
hindernislose Technik - tonliche Unabgegrenztheit:
Busoni nennt hier drei Begriffe, die man darauf befragen
kann,
ob
sie miteinander vereinbar, ob sie überhaupt in sich widerspruchsfrei sind:
- Abstrakter Klang:
Dieses
Stichwort läßt sich interpretieren als Chiffre der Alternative zu einer
Ästhetik,
die
sich mit bereits bekannten klanglichen Möglichkeiten vorgefundener Instrumente
(und
überdies des vorgefundenen Tonsystems, an dem sie sich orientierten) begnügt.
Gleichwohl
läßt sich nicht leugnen,
daß
der Begriff „abstrakter Klang“ eigentlich in sich widersprüchlich ist:
Der
Klang ist nicht abstrakt, sondern sinnlich wahrnehmbar, also konkret.
- Hindernislose Technik:
Wenn
als Ziel der Technik die Überwindung von Hindernissen angenommen wird,
dann
kann hindernislose Technik
als
eine Technik interpretiert werden, die ihr Ziel vollständig erreicht.
Fragen
ließe sich allerdings, ob in dieser Perspektive
der
Einsatz von Technik, zumal in der Musik, nicht allzu idealistisch eingeschätzt
wird:
Ist
die ideale Technik wirklich diejenige, deren Einsatz man gar nicht mehr
bemerkt?
Ist
nicht vielmehr der Einsatz von Technik in ästhetischen Zusammenhängen
in
vielen Fällen wichtig genug, um bewußt wahrgenommen
und
auf (mehr oder weniger weit reichende) Konsequenzen befragt zu werden?
- Tonliche Unabgegrenztheit:
Dieser
Begriff könnte paradox erscheinen,
wenn
man seine Verbindung mit dem Stichwort „hindernislose Technik“ in Betracht
zieht.
Busoni versucht, in seinem Text diese (scheinbare oder
tatsächliche) Paradoxie dadurch aufzulösen,
daß
er strenge technische Kontrolle geradezu als Voraussetzung für die adäquate
Materialisierung
der
völlig freien, von allem Konventionellen abgelösten kompositorischen Erfindung
annimmt:
Je
freier die ursprüngliche kompositorische Inspiration,
desto
strenger gebunden, desto rigoroser festgelegt
ist
das letztlich aus ihr hervorgehende kompositorische Resultat.
(Diese
Dialektik wird in Busonis Text
deutlich benannt -
sogar
dann, wenn er einen Bericht über eine damalige Erfindung zitiert,
dessen
Bedeutung für die Erneuerung der Musik
erst
ein halbes Jahrhundert später konkret erkennbar werden sollte,
in
den Anfangsjahren der strukturellen elektronischen Musik.
Busoni zitiert hier, wie Ray
Stannard Baker das Dynamophone
beschreibt,
einen
von Thaddeus Cahill erfundenen
Ton- und Klanggenerator.
In
der Beschreibung heißt es:
Dr. Cahill ersann die Idee eines Instruments, welches dem Spieler
die absolute Kontrolle
über jeden zu erzeugenden
Ton und über dessen Ausdruck gewährte.
Er nahm sich die Theorien Helmholtz´ zum Vorbild, die ihn
lehrten,
daß die Verhältnisse der
Zahl und der Stärke der Obertöne zum Grundton
den Ausschlag für den
Klangcharakter der verschiedenen Instrumente geben.
Demnach konstruiert er zu
dem Apparat, welcher den Grundton schwingen läßt,
eine Anzahl supplementärer
Apparate, von welchen jeder einen der Obertöne erzeugt,
und konnte solche in
beliebiger Anordnung und Stärke dem Grundton zuhäufen.
So ist jeder Klang einer
mannigfaltigsten Charakterisierung fähig,
sein Ausdruck auf das
empfindlichste dynamisch zu regeln,
die Stärke vom fast
unhörbaren Pianissimo bis zur unerträglichen Lautmacht zu produzieren.
Und weil das Instrument von
einer Klaviatur aus gehandhabt wird,
beibt ihm die Fähigkeit
bewahrt, der Eigenart eines Künstlers zu folgen.[3])
Busoni beruft sich auf eine Erfindung, die mit
größtmöglicher technischer Präzision
die
möglichst genaue Realisierung von frei erfundenen Ton- und Klangstrukturen
ermöglichen soll:
Durch
exakte Regulierbarkeit der Grundfrequenzen
und
durch exakte Abstufungen ihrer Obertöne.
Was
damals technisch sehr aufwendig und schon deshalb nicht umstandslos praktisch
nutzbar war,
ließ
sich rund 50 Jahre später mit Sinustongeneratoren wesentlich einfacher
realisieren
(allerdings
immer noch mit erheblichem Arbeitsaufwand,
am
besten in der Exklusivität eines elektronischen Studio;
fast
weitere 50 Jahre sollte es dauern, bis diese Techniken sogar auf Heimcomputern
ausführbar geworden waren.)
Die
Frage liegt nahe, wie Busoni zu
seiner Zeit
das
Ideal der technisch ermöglichten „absoluten Kontrolle“
mit
seinem höchsten musikästhetischen Ideal der „Freiheit“ vereinbaren wollte,
das
zu Beginn seiner Abhandlung eingeführt wird,
wo
er die ästhetisch freie (oder wieder zu befreiende) Tonkunst,
in
der Abgrenzung von anderen, älteren Künsten,
als
jungfräuliches Kind beschreibt. Er sagt:
Das Kind - es schwebt! (...)
Es ist fast unkörperlich.
(...)
Es ist fast die Natur
selbst. Es ist frei.
(...)
Frei ist die Tonkunst
geboren und frei zu werden ihre Bestimmung.[4]
Wenn
die Freiheit der Tonkunst sich aus kompositorischer Freiheit ergeben soll,
kommt
nach Busonis Worten deren
dialektische Bindung an das Gesetz ins Spiel -
allerdings
nicht an ein vorgefundenes, unkritisch übernommenes Gesetz,
sondern
an ein Gesetz,
das
der Schaffende in vollständiger ästhetischer Autonomie sich selbst stellt.
In
diesem Sinne postuliert Busoni:
Die Aufgabe des Schaffenden
besteht darin, Gesetze aufzustellen, und nicht, Gesetzen zu folgen.[5]
Die
Dialektik zwischen technischer Kontrolle und kreativer Freiheit
hat
Busoni in seinem ästhetischen
Entwurf konkretisiert, aber nicht definitiv bewältigt.
Dies
hat schon Arnold Schönberg
bemerkt,
als
er in sein Handexemplar der 1916 erschienenen 2. Auflage des Busoni-Entwurfs
kritische
Anmerkungen eintrug.
Busonis widersprüchliche Einstellung zum Problem
musikalischer „Gesetzgebung“
analysierte
Schönberg am Beispiel neu
eingeführter Skalen.
Zu
entsprechenden Vorschlägen Busonis
und zu den ihnen entsprechenden Regeln schrieb er:
Angenommen, ein Musiker
erlernte allmählich diese Regeln
und brächte es dahin, sie
mit Sicherheit anzuwenden:
was sagt dann das
freischwebende göttliche Kind dazu; wie verhält es sich zu dieser Freiheit?[6]
Die
Frage, ob und inwieweit die künstlerische Erfindung
sei
es frei, sei es auf materiale (z. B. technische) Voraussetzungen und
Hilfsmittel angewiesen ist,
ist
aktuell geblieben bis über die Grenzen des 20. Jahrhunderts hinaus.
Busoni mußte sich von Schönberg
beim Wort nehmen lassen, als er vorgeschlagen hatte,
im
konventionellen zwölftönig-temperierten Tonsystem neue Skalen zu bilden:
durch
Auswahl siebenstufiger Skalen mit neuen, damals noch nicht standardisierten
Stufenabständen.
Dieser
Vorschlag verblieb in den Grenzen kombinatorischer Phantasie -
und
überdies ließ er offen,
warum
- in der Bindung an solche Skalen im Rahmen der vollständig verfügbaren
Chromatik -
der
Komponist sich a priori
auf
die Auswahl bestimmter Stufen und auf die Auslassung anderer Stufen festlegen
sollte.
Gegenüber
dieser Vorstrukturierung der Tonhöhen hat Schönberg
damals -
in
seiner Phase der „freien Atonalität“, d. h. vor seiner Etablierung der
Reihenmusik -
der
freien Erfindung im chromatischen Total den vorzug gegeben,
wie
er sie im Flötensolo seines Pierrot
lunaire exemplarisch verwirklicht.
Wahrscheinlich
hat Schönberg damals, als er Busoni kritisierte, schon ahnen können,
daß
die Bindung an vorgegebene, sei es auch vom Komponisten neu erfundene Skalen
zumindest
im Grundansatz
eher
vom kombinatorischen Kalkül ausgeht als von der spontanen Inspiration.
Der
Weg der Auswahl von Skalen aus dem chromatischen Total, war Schönbergs Sache nicht.
Im
Gegenteil:
Ihn
störte auch später in seiner Reihenmusik die Monotonie der chromatischen
Tonfolge keineswegs,
da
diese ja durch eine spezifische, einmalige Reihen-Disposition
jeweils
von Werk zu Werk wechselnd aufgehoben werden konnte.
Neue
Prinzipien der Skalenbildung, wie sie Busoni
vorgeschlagen hatte,
sind
später, in allgemeinerer Form (über die Siebenstufigkeit hinausgehend)
vor
allem für Olivier Messiaen
personalstilistisch wichtig geworden
(und
zwar in der Praxis nicht nur seiner Komposition, sondern auch seiner
Improvisation).
Von
hier aus war es allerdings de facto noch ein relativ weiter Weg
bis
zur systematischen Skalen-Konstruktion mit technischen Hilfsmitteln,
wie
sie etwa in den späten 1970er Jahren Klarenz
Barlow
bei
der Materialvorbereitung für seine Komposition Cogluotobüsisletmesi vorgenommen hat
(und
dann letztlich für die Komposition selbst doch nur eine eindeutige
Auswahlentscheidung traf,
die
auch ohne Einschaltung des Computers möglich gewesen wäre;
in
diesem Werk wird deutlich, daß die Computertechnologie
in
anderen, weniger elementaren Ordnungsbereichen der Musik weitaus wichtiger sein
kann:
bei
der Berechnung von Partiturdaten,
bei
ihrer Anpassung an die spieltechnischen Möglichkeiten des Klaviers
und
bei der Realisation einer Fassung für digital elektronische Klangerzeugung).
Die
Freiheit der Tonkunst -
die
Freiheit der künstlerischen Setzung des Tonkünstlers,
die
auch die Freiheit zur Aufstellung eines neuen, womöglich äußerst strengen
Gesetzes sein kann:
Busoni konfrontiert beides im ungelösten Konflikt.
Seine
eigenen Prämissen erlauben es ihm nicht, a priori festzulegen,
wie
der Komponist seine schier unermeßliche Freiheit tatsächlich nutzen,
wie
er sie konkret übersetzen soll in exakt fixierte Parameter eines synthetischen
erzeugten Klanges.
Daß
der Komponist
bei
der Formulierung seiner Gesetze von technischen Gegebenheiten ausgehen könnte,
zieht
Busoni in seinem „Entwurf“
nirgends in Betracht,
da
sich dies mit den Prämissen seiner Autonomie-Ästhetik nicht vertragen würde.
Statt
dessen knüpft Busoni an Richard Wagner an,
der
(in Die Meistersinger von Nürnberg)
seinen
Ritter Stolzing den Meister Sachs befragen läßt:
Wie fang´ ich nach der Regel
an?
Wagners Antwort, aus dem Munde von Hans Sachs, lautet:
Ihr stell´t sie selbst und folgt ihr dann.[7]
Diesen
Rat übernimmt auch Busoni,
wenn
er dem Komponisten, der als Gesetzgeber auftreten will, Empfehlungen gibt.
Busoni schreibt:
Der Schaffende sollte kein
überliefertes Gesetz auf Treu und Glauben hinnehmen
und sein eigenes Schaffen
jenem gegenüber von vornherein als Ausnahme betrachten.
Er müßte für seinen eigenen
Fall ein entsprechendes eigenes Gesetz suchen, formen,
und es nach der ersten
vollkommenen Anwendung wieder zerstören,
um nicht selbst bei einem
nächsten Werke in Wiederholungen zu verfallen.[8]
Dieses
Postulat läßt sich lesen als idealtypische Definition
einer
neuartigen, aus ihren eigenen Prämissen herauswachsenden Konstruktivität,
wie
sie später, seit den 1920er und 1950er Jahren,
in
der zwölftönigen und mehrdimensional-seriellen Musik versucht worden ist -
am
radikalsten in der frühen seriell-elektronischen Musik.
Erst
später, nach der Formulierung mehr oder weniger abstrakter,
von
der Möglichkeit unmittelbarer praktischer Umsetzung zunächst noch weit
entfernter Ideale,
in
der konkreten Arbeit der Ausarbeitung einer kompositorischen Konstruktion
und
ihrer klanglichen Realisierung im elektroakustischen Studio,
konnte
dann auch deutlich werden,
daß
die Autonomie künstlerischer Setzung durchaus begrenzt blieb,
da
sie offensichtlich von physikalischen und technischen Gegebenheiten abhängig
war.
Das
Verhältnis zwischedn Technologie und künstlerischer Kreativität,
zwischen
Technologie und Kunst,
spielt
für die Produktion ebenso wie für die Rezeption von Musik
dann
eine noch relativ unwichtige Rolle,
wenn
es nur um die technisch gestützte Konstruktion neuer Skalen
innerhalb
eines bereits bekannten Tonsystems geht.
Eine
andere Situation kann sich allerdings dann ergeben,
wenn
das Tonsystem selbst in Frage gestellt wird.
Dies
läßt sich bereits in Busonis
Entwurf erkennen -
in
Passagen, die sich lösen
von
seinen und Schönbergs damaligen
Vorstellungen spontaneistischer Inspirations-Ästhetik,
(wie
sie später etwa für Edgard Varèse,
später partiell auch für Wolfgang Rihm relevant
werden,
aber
das Verhältnis zwischen Musik und Technologie nur in Sonderfällen tangieren
sollten).
Auch
hier, bei der Diskussion von Alternativen zur tradierten zwölftönigen System,
gerät
Busoni allerdings wieder in
Konflikt mit seinen widerstreitenden ästhetischen Prämissen:
Er
kann alte Ordnungen nicht in Frage stellen, ohne neue vorzuschlagen.
Busoni empfiehlt die mikrotonale Aufspaltung
der
traditionellen, auf Halb- und Ganzton aufbauenden Tonstrukturen
als
Voraussetzung zu einer Umwälzung harmonischen Denkens,
die
nach seinen Worten von einer zeitbedingten zu einer „ewigen“ Harmonie führen
kann.
Er
schreibt:
Vergegenwärtigen wir uns
(...), daß (...) die Abstufung der Oktave unendlich ist,
und trachten wir, der
Unendlichkeit um ein weniges uns zu nähern.
Der Drittelton pocht schon
seit einiger Zeit an die Pforte (....)[9]
Der
Übergang vom Zwölftonsystem zur mikrotonalen Tonordnungen
erschien
Busoni offensichtlich als ein so
radikaler Einschnitt,
daß
er, zumindest vorläufig, einige Vorsichtsmaßnahmen für unerläßlich hielt.
Als
kleinen ersten Schritt auf dem langen Wege zur tonlich-intervallischen
„Unbegrenztheit“
empfiehlt
er den Übergang vom Halbtonschritt zum Dritteltonschritt:
Der
Ganztonschritt,
das
Basisintervall der damals als Innovation viel verwendeten und diskutierten
Ganztonleiter,
soll
nicht mehr in zwei, sondern in drei Teile geteilt werden:
Ganztonschritt (200 Cents) =
Halbtonschritt +
Halbtonschritt (100 + 100 Cents) =
Dritteltonschritt +
Dritteltonschritt + Dritteltonschritt (66,6... + 66,6... + 66,6... Cents)
Selbst
dieser erste Schritt erscheint Busoni
nicht unbedenklich:
Er
impliziert, wie schon die Ganztonleiter selbst,
den
Verzicht auf aus der Tradition wohlbekannter Intervalle
(z. B. Halbton, kleine Terz und reine Quinte).
Diese
unwillkommene Einschränkung kompensiert Busoni
in paradoxer Weise dadurch,
daß
er das Raster seiner Mikrotonalität verfeinert:
Er
vervollständigt die Ganztonleiter zum chromatischen Total,
indem
er sie mit ihrer Transposition um einen Halbton höher verschränkt;
er
unterteilt beide Ganztonsegmente in Dritteltonschritte,
verschränkt
sie mikro-chromatisch ineinander und erhält so Sechsteltonschritte.
Hörbeispiel (22-23): Ganzton;
Halb-, Drittel-Tonschritte; Sechstel-Tonschritte (2-3-4-7 Töne)
- 1 Ganztonschritt (a1-h1);
2 Halbtonschritte, 3 Dritteltonschritte; - 6 Sechsteltonschritte
Über
die kompositorische Verwendung der von ihm vorgeschlagenen Mikrointervalle
äußert
Busoni sich nicht.
Offensichtlich
hält er sie aber für schwierig genug,
um
sich nicht allein auf ihre Erprobung mit herkömmlichen Klangmitteln (Stimmen
und Instrumenten) zu verlassen.
Statt
dessen empfiehlt er die Verwendung des Dynamophons mit exakt einstellbaren
Frequenzen.
Es
sollte fast ein halbes Jahrhundert dauern,
bis,
im Sinne des Vorschlages von Busoni,
neue
Tonsysteme mit technischen Hilfsmitteln realisiert und kompositorisch erprobt
werden sollten:
in
der elektronischen Musik.
1954
realisierte Karlheinz Stockhausen
seine elektronische Tonbandkomposition Studie II.
Auch
die Tonstruktur dieser Komposition basiert auf Temperierungen neuer Art:
auf
Unterteilungen vorgegebener Intervalle in gleichen Abständen.
Dabei
geht Stockhausen nicht von der
Oktave als Standardintervall aus,
sondern
von einer etwas komplizierteren Intervallproportion:
Vom
Intervall 1:5 (zwei Oktaven und eine große, reine Terz).
Dieses
Intervall teilt er zu gleichen Teilen auf:
Nicht
in 4 Teile
(wie
es sich im tradierten Tonsystem mit 4 Quintschritten näherungsweise darstellen
ließe),
sondern
in 5 Teile
(mit Intervallen, die deutlich kleiner sind als die reine Quinte und ihre
Vielfachen):
Eine
neuartige Temperierung führt zu neuartigen Intervallen.
Hörbeispiel (24): 1.
Demonstration zu Stockhausen, Studie II:
Fünfteilung des
Ausgangsintervalls 1:5 (100 Hz: G - 500 Hz: h1)
Grundintervall G -h1,
1:5 (2786 Cents), 2 Töne - Fünfteilung ( 6 Töne, Abstand je 557,2 Cents)
Die
Fünfteilung des Tonraumes ist eine Regel,
die
Stockhausen in seiner Studie II sich selbst stellt -
und
zwar nicht nur für das der Naturtonreihe entstammende Ausgangsintervall,
das
in der Komposition selbst nicht konkret hörbar wird,
sondern
vor allem auch für dessen neuartige Unterteilungen:
Der
fünfte Teil dieses Intervalls,
ein
Intervall ungefähr in der Mitte zwischen reiner Quart und Tritonus,
wird
wiederum in fünf gleiche Teile aufgespalten,
die
etwas größer sind als temperierte Halbtöne.
Hörbeispiel (25): 2.
Demonstration zu Stockhausen, Studie II:
Fünfteilung des
Fünftelintervalls 1:51/5 (100 Hz: G - 138 Hz: zwischen c und cis)
557,2 Cents aufwärts ab G -
Unterteilung in 6 Töne mit 5 gleichen Abständen (je 111,4 Cents)
Das
Tonsystem in dieser Komposition ist nicht aus der Tradition übernommen,
sondern
ergibt sich aus einer vom Komponisten für dieses Werk - und nur für dieses Werk
-
festgelegten
Gesetzmäßigkeit.
Die
Orientierung an der Intervallzahl 5 und an deren temperierter Fünfteilung
ist
keine isolierte musiktheoretische Festlegung,
sondern
eine kompositorische Entscheidung, die in engstem Zusammenhang
zur
Gesamtanlage des Stückes steht:
Die
gesamte Konstruktion des Stückes wird,
auf
allen Gliederungsebenen vom kleinsten Detail bis zur Großform,
von
der Zahl 5 geprägt -
nicht nur, aber besonders sinnfällig im Bereich des Parameters Tonhöhe.
Besonders
sinnfällig wird dies in der Gruppierung der Töne:
Alle
Sinustöne erscheinen in Fünfergruppen mit gleichen Tonabständen,
die
sich, gleichsam akkordisch, zu Tongemischen überlagern.
Im
einfachsten Falle ist der Tonabstand identisch mit der kleinsten Skalenstufe,
die
etwas größer als ein Halbton ist.
Wenn
sich 5 Sinustöne in diesen engen Abständen überlagern,
entsteht
ein Tongemisch, dessen Töne sich auf engstem Raum zusammendrängen.
Hörbeispiel (26): Studie II,
Tongemisch mit Breite 1: 5 Töne nacheinander - überlagert
(Quasi-Cluster)
Dieser
engste Tonabstand ist eine von fünf verschiedenen Möglichkeiten.
Er
ergibt sich, indem von einer Skalenstufe zur nächst benachbarten übergegangen
wird (Breite 1).
Andere
Möglichkeiten - und mit ihnen andere Klang-Färbungen bei der Überlagerung -
ergeben
sich bei weiteren Abständen der Teiltöne:
beim
Übergang von einer Skalenstufe
zur
übernächsten, drittnächsten, viertnächsten und fünftnächsten (Breiten 2, 3, 4
und 5).
Die
weiteste Variante (Breite 5) unterscheidet sich am deutlichsten
von
der engsten, clusterartigen Zusammenpressung der Töne:
Die
Überlagerung weit entfernter Töne läßt sich hören wie ein Akkord.
Hörbeispiel (27): Studie II,
Tongemisch mit Breite 5: 5 Töne nacheinander - überlagert
(Quasi-Akkord)
Die
gesamte Tonstruktur des Stückes basiert auf 5 verschiedenen
Klangfarben-Varianten,
die
sich aus unterschiedlichen Abständen der Töne je Tongemisch ergeben.
Alle
formalen Gliederungen ergeben sich aus 5 verschiedenen
Gruppierungsmöglichkeiten
von
Tongemischen gleicher „Farbe“ (bzw. gleicher „Breite“):
Jede
Gruppe enthält entweder 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 Tongemische einer
bestimmten Breite.
Im ersten Teil des Stückes folgen die Töne
innerhalb einer Gruppe aufeinander -
in
ähnlicher Weise miteinander verbunden wie Legato-Töne einer Melodie.
Die
verschiedenen, quasi-melodischen Gruppen unterscheiden sich durch Breite bzw.
Klangfarbe;
meistens
sind sie durch Zwischenpausen getrennt,
an
einigen Stellen kommt es auch zur Überlagerung zweier verschiedener Gruppen.
Die
Entwicklung führt bis zu einem Akzent, der einen neuen Teil eröffnet.
Hörbeispiel (28): Studie II,
1. Teil bis Anfangsakzent 2. Teil
Der
Akzent, der den zweiten Teil des Stückes eröffnet,
präsentiert
zugleich eine neue, für diesen Teil typische Art der Tonverbindung:
Verschiedene,
im Tonraum benachbarte Tongemische gleicher Breite verbinden sich hier
nicht
in der Aufeinanderfolge, quasi melodisch,
sondern
in der Überlagerung, quasi akkordisch
(z. B. mit Tongemischen, die alle gleichzeitig einsetzen
und
dann, sich gleichsam ausfransend, individuell verschieden aussetzen).
Insgesamt
gibt es 5 verschiedene Formteile
mit
charakteristisch unterschiedlichen Gruppierungsweisen der Tongemische:
Quasi
legato in enger Lage - quasi akkordisch in enger Lage -
quasi
staccato in weiter Lage und in extremer Dynamik - quasi akkordisch in weiter
Lage -
Kombination
aller Möglichkeiten.
Obwohl
viele Aspekte des Stückes sich mit Begriffen beschreiben lassen,
die
auch auf traditionelle Instrumentalmusik anwendbar sind,
bleibt
deutlich, daß die gesamte musikalische Konstruktion
zwingend
auf die technischen Möglichkeiten der elektronischen Tonbandproduktion
angewiesen ist:
Exakte
Regulierung der Frequenzen und der dynamischen Werte -
minutiöse
Fixierung von Zeitwerten durch Bandschnitt.
Was
Busoni im Bereich neuer
Tonordnungen relativ präzis vorausgesehen hatte
(und
was er in anderen Bereichen vielleicht
vorausahnte -
etwa
im Bereich der dynamischen Gestaltung,
den
er unter dem Stichwort „Ausdruck“ allerdings noch nicht der Komposition,
sondern
eher der Interpretationsfreiheit des ausübenden Musikers zuzuordnen scheint,
hat
sich in den frühen 1950er Jahren konkretisiert in einer Kompositionstechnik,
die
nicht nur die Tonhöhen, sondern auch die Lautstärken und Zeitwerte -
und
in einfachen Sonderfällen überdies auch die Klangfarbe -
präzisen
kompositorischen Kontrollen zu unterwerfen versucht.
Die
von Busoni propagierte
kompositorische Freiheit realisiert sich hier
in
der (scheinbaren) Paradoxie des dialektischen Umschlags:
als
rigorose kompositorische Kontrolle auf der Basis neu erfundener
Gesetzmäßigkeiten -
in
Konstruktionen, die in letzter Konsequenz dem Interpreten keinen Freiraum mehr
belassen
und
für die deswegen die eindeutig fixierende Tonband-Realisation im Studio
am
geeignetesten erscheint.
Diese
extreme Situation änderte sich allerdings relativ rasch, und zwar:
-
einerseits deswegen, weil selbst ein radikal konstruktivistischer Komponist wie
Stockhausen
dem
Monopol des extremen Determinismus bald zu mißtrauen begann
und
sich für neue Unbestimmtheiten interessierte,
wie
sie zunächst in einer erneuerten Instrumentalmusik leichter erreichbar schienen
als
in der damaligen elektronischen Studiotechnik;
-
andererseits deswegen, weil allmählich auch den Komponisten elektronischer
Musik deutlich wurde,
daß
sie mit ihren streng vorfixierten Reihen-Konstruktionen
die
vielfältigen neuen Möglichkeiten der elektronischen Klangproduktion und
Klangverarbeitung
bei
weitem nicht ausschöpfen konnten.
Je
weiter das ursprüngliche Klangmaterial im Studio verarbeitet wurde,
desto
weniger ließ sich seine ursprüngliche Strukturierung noch heraushören.
Die
eigentlich wichtigen Details der Studioarbeit,
die
fortwährenden Verarbeitungen von Klangmaterialien
in
verschiedenen Verarbeitungsschritten (mit jeweils unterschiedlichen Varianten)
ließen
sich in den ausgeführten Kompositionen meistens nicht mehr identifizieren -
es
sei denn in bestimmten Ausnahmefällen,
bei
denen der Komponist es ausdrücklich auf Erkennbarkeit seiner
Klang-Transformationen anlegte.
Ein
charakteristisches, auch im unmittelbaren Höreindruck weitgehend
nachvollziehbarer Beispiel
für
die Akzentverlagerung
von
der strengen Vorstrukturierung des Klangmaterials auf die Empirie der
Klangtransformation
ist
die Tonbandkomposition Terminus I von
Gottfried Michael Koenig:
Das
Ausgangsmaterial dieses Stückes ist homogen, aber weitgehend unstrukturiert:
Es
sind mehr oder weniger zufällig gewählte Ausschnitte
aus
einem Knäuel von 5 glissandierenden Sinustönen.
Maßgeblich
für die Konstruktion des Stückes sind nicht diese Ausschnitte selbst,
sondern
ihre Versetzung auf verschiedene Transpositionsstufen, in winzigen
Mini-Fragmenten.
Aus
diesen Mini-Fragmenten hat Koenig
verschiedene Strukturen zusammenmontiert, die -
in
verschiedenen Varianten der Klangverarbeitung -
zur
Basis verschiedener Formteile des Stückes geworden sind.
Z.
B. hört man zu Beginn des 1. Teils eine Ausgangsstruktur,
die
der dann verschiedene elektronisch transformierte Varianten folgen.
Die
Identität des Ausgangsklanges bleibt auch in den folgenden Varianten weitgehend
gewahrt:
Zwei
Klangbänder, im Zentrum getrennt durch drei kurze Klangsignale.
Klangbeispiel (35): Koenig,
Terminus, 1. Teil
Der
Werktitel Terminus verweist auf ein
Endstadium:
auf
eine Extremposition, die die analoge elektronische Tonbandkomposition erreicht
hatte
im
Spannungsfeld einer Entwicklung,
die
einerseits den kompositionsgeschichtlichen Anforderungen
an
Komplexität und strukturelle Strenge gerecht zu werden versuchte,
andererseits
aber auch die Möglichkeiten moderner Studiotechnik
möglichst
weitgehend auszuschöpfen bestrebt war.
Dabei
konnte sich herausstellen, daß die Möglichkeiten des modernen Elektronischen
Studios
gar
nicht in jedem Falle mehr Kompositionsweisen begünstigten,
die,
insoweit noch ganz im Geiste avantgardistisch-struktureller Instrumentalmusik,
auf
exakter kompositorischer Vorauskontrolle und Voraussagbarkeit beruhten.
Die
Erwartungen, mit denen Musiker wie Busoni
und (später, an ihn anknüpfend,) Varèse,
seit
den frühen 1950er Jahren auch serielle Komponisten wie Goeyvaerts und Stockhausen
sich
anfangs auf eine Kunst technisch produzierter Klänge zubewegt hatten,
waren
zunächst relativ abstrakt
und
ergaben sich weitgehend aus dem Versuch,
bisherige
musiktheoretische und kompositorische Denkansätze abstrahierend zu
verallgemeinern.
Diese
Erwartungen konnten sich, wenn überhaupt, dann allenfalls nur
vorübergehend
in einem relativ einfachen Stadium der technischen Entwicklung erfüllen -
zu Busonis Zeiten, technisch aufwendig und
unvollkommen, mit dem Dynamophon,
später,
einfacher, mit Sinustongeneratoren, Potentiometer und Bandschnitt.
Sobald
die Komponisten konkrete Erfahrungen in der Studioarbeit sammeln konnten,
stießen
sie allerdings früher oder später auf Phänomene,
die
von den theoretischen Vorerwartungen abwichen
und
die Theorie und Praxis der kompositorischen Arbeit wesentlich veränderten:
Mit
Hallgeräten und Filtern beispielsweise konnte man, anders als mit Generator und
Potentiometer, nicht ohne weiteres seriell komponieren.
Damit
mußte sich Karlheinz Stockhausen
schon 1954 in seiner Studie II abfinden,
die
er am liebsten nicht mit unterschiedlich breiten Tongemische komponiert hätte,
sondern
mit unterschiedlich breiten Geräuschbändern.
Um
die ersatzweise gewählten Tongemische den Geräuschen einigermaßen anzunähern,
hat
Stockhausen sie dann einer elektroakustischen Transformation unterworfen,
die
die ursprünglichen Tonstrukturen ein wenig verwischen sollte: der Verhallung.
Dies
war ein symptomatischer Schritt:
Die
Details der ursprünglichen kompositionstechnischen Differenzierung kein
Selbstzweck,
sondern
wurden in der studiotechnischen Differenzierung modifiziert, wenn nicht gar in
Frage gestellt.
Die
Suche nach neuen Skalen und Akkorden, nach neuen Melodien und Harmonien
sollte
nicht das einzige Resultat des von Busoni
initiierten musikalischen Umdenkens bleiben.
Wichtiger
war ein Neuansatz,
dessen
volle Tragweite Busoni wahrscheinlich
noch nicht ermessen konnte
und
der sich in seinem Text eher indirekt erschließen läßt
(aus
seinem Bericht über das Dynamophon):
Eine
Technik, die dem Komponisten das Eindringen in das Innere eines musikalischen
Klanges erlaubt
(in
seine Obertonstruktur, in seine Klangfarbe)
bietet
wichtige Ansatzmöglichkeiten für neue kompositorische Verfahren,
die
bis in die Mikrostruktur des Klanges eindringen.
Sie
kann auch dem Musikhörer konkrete Erfahrungen zugänglich machen,
die
dieser sonst allenfalls aus akustischen Lehrbüchern und Experimenten kennen
könnte:
Die
Erkenntnis, daß das, was der traditionell geschulte Musiker als einfachen Ton
wahrnimmt,
in
Wirklichkeit eine komplexe Klangfarbe ist,
deren
Spezifik sich nicht nur aus der Höhe ihres Grundtons ergibt,
sondern
vor allem auch aus Auswahl und dynmischer Abstufung seiner Teiltöne.
Hörbeispiel (36):
Sägezahnklang (As) - Aufbau aus den Teiltönen von 1 bis 12
Die
„Musik-Töne“ der konventionellen Instrumente und der Singstimmen
kann
der Physiker als zusammengesetzte Phänomene,
als
„Physik-Klänge“ spezifischer Klangfarbe analysieren
oder
auch, umgekehrt, durch Auswahl und dynamische Dosierung von Teiltönen,
synthetisch
um- oder sogar völlig neu gestalten.
Ein
Musiker, der sich dies zunutze macht,
schafft
sich damit einfaches Verfahren der Klangfarben-Komposition.
Ein
relativ ausführlich dokumentiertes Beispiel früher synthetischer Klangerzeugung
in diesem Sinne
findet
sich in den ersten Arbeitsaufzeichnungen,
die
Karlheinz Stockhausen 1953 nach
Eintritt in das Kölner Elektronische Studio gemacht hat.
Die
klanglichen Resultate sind derzeit öffentlich nicht zugänglich, womöglich nicht
mehr existent.
Sie
lassen sich aber nach den Aufzeichnungen des Komponisten rekonstruieren.
Der
erste Arbeitsschritt war die Auswahl von
Teiltönen:
Beschränkung
auf 6 Teiltöne -
Beschränkung
auf ungeradzahlige Teiltöne (d. h. Auswahl einer klarinettenartigen Klangfarbe)
-
Auswahl
der ersten sechs ungeradzahligen Teiltöne: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11.
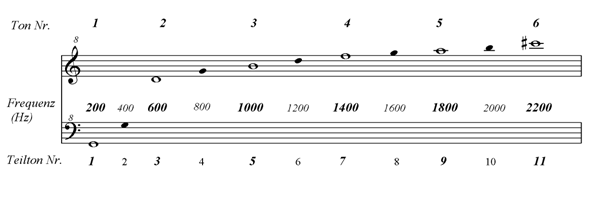
Hörbeispiel (37):
Obertonaufbau mit Grundton 100 Hz:
1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11
(sukzessiv einsetzend: Quasi-Arpeggio)
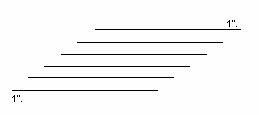
Bei
den so zusammengesetzten Obertonspektren
können
die Töne nicht nur in Überlappungen einsetzen,
sondern
auch gleichzeitig beginnend und endend:
im
kompakten „Schlagklang“ -
mit
einer charakteristischen Hüllkurve, rasch anschwellend und ruhig abschwellend.
Hörbeispiel (38): Spektrum
1-3-5-7-9-11 als Schlagklang
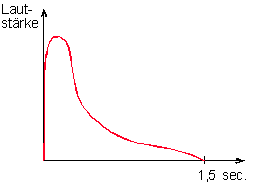
Die
Klangfarben der so erzeugten Spektren lassen sich variieren,
inde
die Lautstärkeabstufungen der sechs Teiltöne variiert werden, z. B. in 6
Varianten.
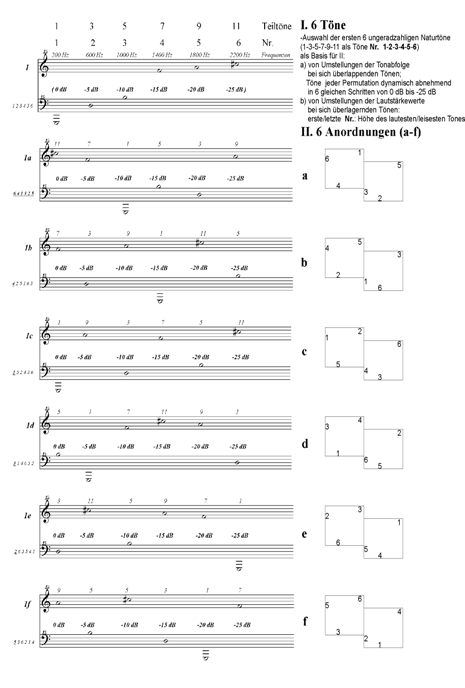
Hörbeispiel (39): 6
Klangfarben-Varianten des Schlagklanges 1-3-5-7-9-11
(gleiche
Lautstärke-Differenzen; zum lautesten Ton werden nacheinander
die Naturtöne 11-7-1-5-3-9
bzw. die Spektraltöne 6-4-1-3-2-3)
Diese
und andere aus dem Ausgangsspektrum abgeleitete Klänge bleiben farblich einfach
-
auch
dann, wenn wie miteinander kombiniert und klanglich verarbeitet werden -
zum
Beispiel ausgehend von 2 Spektren mit sich überlappenden, ein- und ausfädelnden
Tönen,
die
zunächst einzeln erklingen,
dann
überlagert (in additiver Mischung),
dann
miteinander moduliert werden (in multiplikativer Mischung durch
Ringmodulation):
Die
klangliche Komplexität steigert sich - allerdings nur geringfügig.
Hörbeispiel (40): Zwei
Spektren und ihre Verarbeitung:
a, b (die beiden einzelnen
Spektren)
a+b (Überlagerung, additive
Mischung)
a.b (Ringmodulation,
multiplikative Mischung)
Die
einfachen klanglichen Resultate lassen die Gründe dafür vermuten,
daß
Stockhausen seine Versuchsreihen
nicht weitergeführt in einem Stück ausgearbeitet,
sondern
abgebrochen hat:
Die
Intervall- und Farbkonstellationen statischer Klänge sind zu einfach.
Dieser
Versuch, Musik auf der Basis klassischer Akustik
im
Sinne von von Helmholtz zu
komponieren, blieb vorerst ergebnislos.
Es
sollte mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis elektronische Obertonmusik
auf
einer anderen, tragfähigen Basis entstand:
1965
komponierte Folke Rabe seine
Tonbandkomposition Was??? -
ein
Werk, das Obertonstrukturen nicht in der physikalischen Abstraktion
des
starr unveränderlichen, stationären Klanges präsentiert,
sondern
in charakteristischen Abweichungen von den reinen Intervallproportionen,
die
Prozesse der rhythmischen Belebung in Schwebungen ermöglichen.
Hier
dient, anders als in den früher 1950er Jahren,
die
Technik primär nicht mehr der Hörbarmachung vorgegebener abstrakter
Kompositionsstrukturen,
sondern
der Artikulation organischer Formentwicklungen.
Hörbeispiel (41): Folke
Rabe: Was??? (Anfang)
Folke Rabes Komposition Was???
weist den Weg zu späteren Tendenzen der Spektralmusik,
die
häufig von Erfahrungen der Arbeit im Elektronischen Studio ausgehen,
diese
allerdings häufig in den Bereich der Instrumentalmusik transferieren.
Auch
Karlheinz Stockhausen hat, einige
Jahre später als Rabe,
reine
Obertonkompositionen zunächst mit herkömmlichen Klangmitteln realisiert
(vokal
im Sextett Stimmung, instrumental in
der „Parkmusik“ Sternklang).
1953,
in seinem ersten Arbeitsjahr im Kölner Elektronischen Studio,
mußte
er für die Komposition sechstöniger Spektren noch andere Wege finden.
Dabei
orientierte er sich an einem wichtigen Vorbild instrumentaler Reihenmusik:
Am
ersten Satz des Konzerts für 9 Instrumente op. 24 von Anton Webern.
Die
Tonkonstruktion dieses Stückes basiert auf zwei spiegelsymmetrischen
Dreiergruppen,
die
zusammen einen spiegelsymmetrischen Sechsklang ergeben.
Hörbeispiel (42): Webern,
Tonstruktur op. 24 Anfang:
1-3, 4-6 (Spiegel), 1-6: jeweils akkordisch
Entsprechende
Intervallstrukturen finden sich auch in der Tonstruktur,
die
Stockhausen seiner ersten
elektronischen Komposition, der Studie I,
zu Grunde legt:
3+3=6
Töne
Hörbeispiel (43):
Stockhausen, Tonstruktur Studie I:
1-3, 4-6 (Spiegel), 1-6):
jeweils akkordisch
Aus
dem Sechsklang, den Stockhausen so
erhält,
lassen
sich Klangfarben-Varianten bilden
durch
unterschiedliche dynamische Dosierungen der Teiltöne -
z.
B. 6 Varianten mit gleichen Lautstärke-Abständen,
in
denen ein Reihenton nach dem anderen zum lautesten Ton wird.
Hörbeispiel (44): 6
Klangfarben-Varianten (6klang zu Studie 1)
lauteste Töne: Spektraltöne
1-5-4-1-2-3 bzw. 1-5-4, I-V-IV
(Zahlen: 1-6 vom höchsten
zum tiefsten Ton; I-VI Spiegelung, vom tiefsten zum höchsten Ton)
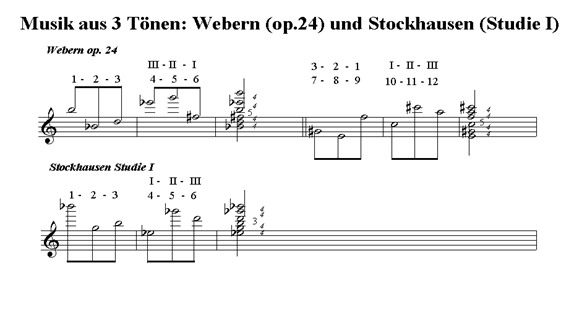
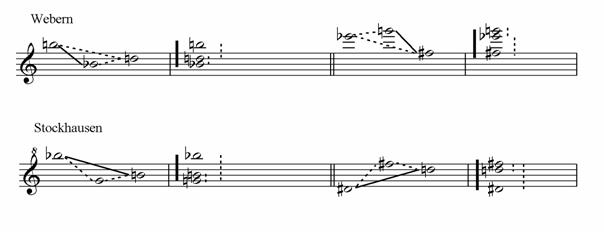
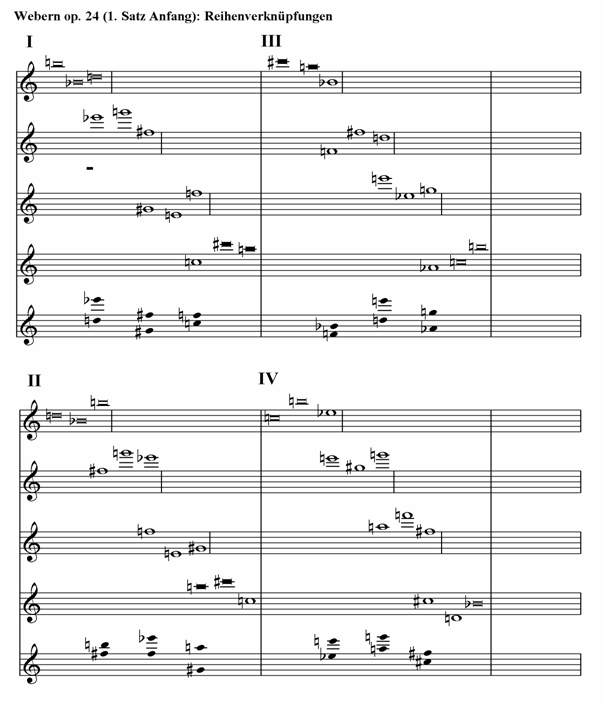
Weberns Konzert
und Stockhausens Studie I ähneln sich in ihren
elementaren Tonstrukturen,
aber
nicht in ihrer kompositorischen Ausarbeitung.
Dies
wird deutlich, wenn man den Anfang des Konzerts
von Webern hört:
Alle
Dreitongruppen sind deutlich zu erkennen -
nicht
nur anfangs, in melodischer Abfolge,
sondern
auch später, in harmonischen Konstellationen
mit
Überlagerungen von zwei oder allen drei Tönen einer Ausgangs-Tonzelle.
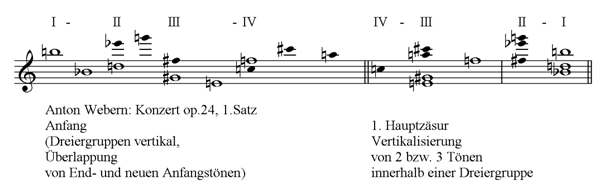
Hörbeispiel (45): Webern,
Konzert op. 24 Anfang
(bis zu den ersten beiden
3tonakkorden, im Klavier)
In Stockhausens Studie I sind die ursprünglichen Dreitongruppen kaum noch zu
erkennen:
Er
faßt sie, zusammen mit Transpositionen, zu größeren Tonkomplexen zusammen
und
bildet dann aus ihnen Akkorde mit ständig wechselnden Werten harmonischer
Dichte:
Er
überlagert nicht durchweg 3 Töne, sondern er beginnt mit 6 unterschiedlichen
Überlagerungen:
4
Töne - 5 Töne - 3 Töne 6 Töne - 2
Töne - 1 Ton
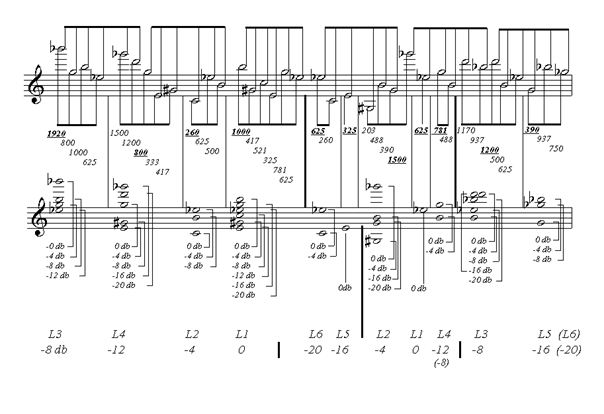
Hörbeispiel (46):
Stockhausen, Studie I: die sechs ersten Tongemische
Anzahlen überlagerter
Sinustöne: 4-5-3 6-2-1
Jedes
dieser Spektrum wird für die Komposition klanglich ausgeformt,
und
zwar in verschiedenen Schritten:
mit
gleich lauten Tönen - mit dynamisch abgestuften Tönen
überlagert
mit gleich lauten Tönen - überlagert mit dynamisch abgestuften Tönen
mit
festgelegter Dauer (Bandschnitt) - mit abgemessener Dauer und anschließender
Verhallung
Hörbeispiel (47):
Stockhausen, Studie I, erstes Tongemisch (4 Töne):
nacheinander gleich laut -
nacheinander dynamisch abgestuft
überlagert gleich laut -
überlagert dynamisch abgestuft
mit abgemessener Dauer
(Bandschnitt) - mit abgemessener Dauer und Nachhall
Die
genauen Details der Tonstruktur und der Klangproduktion
lassen
sich im fertigen Stück nicht ohne weiteres exakt heraushören.
Dies
erklärt sich schon daraus, daß die Klänge zu Beginn des Stückes
nicht
isoliert zu hören sind, sondern in komplexer (vierschichtiger) Überlagerung.
Diese
komplexe Konstruktion dient bei Stockhausen,
anders als bei Webern,
weniger
der sinnfälligen Verdeutlichung
als
der komplexen Verschleierung der ursprünglichen Tonstruktur:
Technik
wird eingesetzt mit dem Anspruch,
das
eigentlich Unhörbare dennoch hörbar zu machen -
d.
h., nach Möglichkeit die Grenzen bisheriger Hörfähigkeit zu erweitern.
Hier
artikuliert sich
ein
anderes Verhältnis zwischen Technologie und künstlerischer Kreativität als bei Busoni:
Die
Technik dient nicht mehr als Hilfsmittel der vorauseilenden,
nach
wie vor autonomen künstlerischen Phantasie,
sondern
als Motor der Veränderung des Menschen.
Spuren
eines so gewandelten Technik-Verständnisses
lassen
sich, im Bereich einer anderen technisch produzierten Kunst,
zurückverfolgen
bis in die Anfangsjahre des avantgardistisch-ästhetisch ambitionierten
Stummfilms.
1923
forderte Dziga Vertov:
Weg frei für die Maschine!
Vertov proklamierte die Wichtigkeit eines neuen, technisch
geprägten Sehens, indem er schrieb:
Das Grundlegende und
Wichtigste ist:
Die
filmische Wahrnehmung der Welt.
Der Ausgangspunkt ist:
die Nutzung der Kamera als
Kinoglaz, das vollkommener ist als das menschliche Auge (...)
Das Auge unterwirft sich dem
Willen der Kamera (...)[10]
Stockhausen geht noch einen Schritt weiter als Vertov:
Er
begnügt sich nicht mit der Revolutionierung des konkreten Seh-Eindrucks,
mit
der Lenkung eines Sinnesorgans (Auge) durch eine Maschine (Kamera),
sondern
er benützt technische Prozesse, um Klangergebnisse hervorzubringen,
die
sich vollständig nicht allein im konkreten Höreindruck entschlüsseln lassen,
sondern
nur in Verbindung mit kompositorischen Skizzen,
die
den Arbeitsprozeß erhellen
(was
auch in instrumentaler, z. B. in instrumental-serieller Musik vorkommen kann)
und
- mehr noch - in Verbindung mit dem Versuch technischer Rekonstruktion,
z.
B. der Identifizierung technischer Transformationen
oder
der Zerlegung in einzelne Klangschichten.
Für
den Hörer bleibt gleichwohl der unmittelbare Eindruck
des
Rätselhaften, kaum zu Entschlüsselnden -
zum
Beispiel am Anfang von Stockhausens
Studie I.
Hörbeispiel (48):
Stockhausen, Studie I Anfang: 1. Struktur
(incl. abschließender
Tieftransposition 12:5)
Schon
1953, in der Frühzeit der Elektronischen Musik,
bezieht
Stockhausen in seiner Studie I eine Extremposition,
die
in ihrer kompromißlosen Radikalität
letztlich
auch den Anstoß zu einem grundlegend veränderten Denken gegeben hat.
Schon der Schluß des Stückes weist diesen Weg,
indem
er die anfangs in polyphoner Vielschichtigkeit verstecken Strukturen
als
klar erkennbare Einzelgestaltungen gleichsam an die Oberfläche holt.
Die
Tendenz, Tonstrukturen aus ihrer rätselhaften Komplexität herauszuhören
und
ihre Beschaffenheit im konkreten Höreindruck nachvollziehbar zu machen,
hat
sich seitdem in der Neuen Musik deutlich verstärkte:
Zunächst,
seit etwa 1954, in der Instrumentalmusik,
später
auch in der elektroakustischen Musik,
bis
hin zu neueren Tendenzen der Computermusik in den 1990er Jahren:
Hans Tutschku verwendet in der Tonstruktur seiner Komposition Sieben Stufen,
dem
Titel entsprechend, sieben verschiedene Tonstufen,
auf
die er einen Gesangston transponiert hat:
Eine
Frauenstimme singt das Wort „ruine“
(die
freie Übersetzung des einem Gedicht von Trakl
entnommenen Wortes „Verfall“).
Hörbeispiel (49): Tutschku:
Material „7 Stufen“
Frauenstimme singt „ruine“,
transponiert auf 7 Stufen (aufsteigend)
Aus
den Überlagerungen der 7 Töne können sich Akkorde ergeben.
Diese
Akkorde können sich zurückverwandeln in einen einzigen Ton,
wenn
alle Töne sich im Glissando auf eine einheitliche Tonhöhe,
z.
B. auf den tiefsten Ton zubewegen.
Hörbeispiel (50): Tutschku:
Material „7 Stufen“
7töniger Akkord auf „ruine“
- Glissandi bis zur Vereinigung auf dem tiefsten Akkordton
Tutschku hat den Arbeitsprozeß dieses Stückes ausführlich
beschrieben.
Der
interessierte Hörer kann die Beschreibung mit der fertigen Komposition
vergleichen
und
dann selbst beurteilen, inwieweit sie den ursprünglichen Kompositionsprozeß
aufdeckt,
oder
- z. B. in Verbindung mit den Ausdrucksvaleurs ihrer Textvorlage -
im
Kontext komplexerer musikalischer Zusammenhänge dialektisch aufhebt.
Hörbeispiel (51): Tutschku:
7 Stufen, Anfang
Die
Entwicklung des technisch produzierten Musik im 20. Jahrhundert,
vor
allem in seiner zweiten Hälfte,
hat
deutlich gemacht,
wie
sich mehr und mehr die Akzente von utopischen Hoffnungen
auf
die Bewältigung real erfahrener Probleme verlagert haben.
Die
wichtigste Einsicht,
die
sich in der Seherfahrung seit den Anfangsjahren des Stummfilms
und
in der Hörerfahrung seit der Erfindung der musique concrète durchgesetzt hat,
besteht
darin, daß die tatsächliche Klangerfahrung
nicht
vordergründig mit der Aufsummierung abstrakter Daten verwechselt werden dürfen
-
unabhängig
davon ob diese sich auf konventionelle Musiktheorie
oder
auf klassische Akustik stützen.
Sowohl
unreflektiert empirische als auch voreilig abstrahierende Denkansätze
sind
rasch an ihre Grenzen gestoßen.
Methoden
der Verarbeitung vorgegebener oder der synthetischen Erzeugung neuartiger
Klänge
werden
nicht mehr gegeneinander ausgespielt,
sondern
sinnvoll miteinander verbunden -
beispielsweise
in der von Ludger Brümmer
neuerdings bevorzugten
Methode
des „physical modelling“,
der
virtuellen Nachbildung und Umgestaltung natürlicher Klangvorgänge.
Das
traditionelle tonstrukturelle, von festen Parameterwerten ausgehende Denken
hat
sich weiter entwickelt im Umgang mit komplexen Klängen,
die
sowohl in ihrer Tonhöhenbestimmung als auch in ihrem Verlauf
sich
traditionellen Methoden der Beschreibung entziehen.
Dies
kann sich realisieren im Miteinander realer und virtueller Klänge,
z.
B. von live gespielten Instrumenten und von vorproduzierten Klängen,
aber
auch, und vielleicht deutlicher noch,
in
einer neuartigen synthetischen Klangwelt,
die
gleichwohl der realen Hörerfahrung, dem Umgang mit bekannten und unbekannten,
komplexen
und reichen Klänge verbunden bleibt.
Hörbeispiel (52): Ludger
Brümmer, Medea (Ausschnitt)